

... Fragen wir heute einmal nicht
nach diesen oder jenen spezifischen Rationalitätskriterien,
fragen wir einmal nicht ob diese Meinung oder jener
Wunsch rational ist oder nicht. Treten wir einen Schritt
zurück und fragen wir einmal nach Geschichte und
Struktur dessen, was wir wissen, 'Begründung' nennen;
nach dem Subjekt, das rational denkt und handelt und
fragen wir nach der Beziehung zwischen diesem Subjekt und
diesem Objekt. Lösen wir uns so von der Vorstellung
eines einsamen Aktors oder einer isolierten
Dialogsituation, von den handlichen Beispielen aus dem
Alltag.
 Befragen
wir nun einen Text, der sich quer legt zu den bisherigen
(sprach-analytischen) Aufsätzen. Schon der Titel: "Dialektik
der Aufklärung" bzw. "Begriff der Aufklärung"
scheint uns vom Thema wegzuführen. Befragen
wir nun einen Text, der sich quer legt zu den bisherigen
(sprach-analytischen) Aufsätzen. Schon der Titel: "Dialektik
der Aufklärung" bzw. "Begriff der Aufklärung"
scheint uns vom Thema wegzuführen.
Keineswegs - betreiben wir nicht gerade das Geschäft der
Aufklärung, wenn wir nach Rationalität fragen, uns in
der Frage der Begründung von theologischen und
metaphysischen, von systematisch irreführenden Begriffen
absetzen und nur akzeptieren, was klar und wohl
unterschieden ist? Beschreiben wir nicht unsere eigene
Persönlichkeit, notwendigerweise oder transitorisch, als
einen defizienten Modus des rationalen, sich selbst gläsernd
durchschauenden Subjekts, das die mythischen Reste von
Selbstvergessenheit und Triebhaftigkeit begreift, und so
wortwörtlich in den Griff nimmt?
Wenn wir so alles befragen, ob es unseren Kriterien der
Rationalität genügt, dann besetzen wir diesen
Richterstuhl mit einem Denken, das sich letztlich selbst
begründet, unbedingt erscheint.
Doch lassen wir uns warnen:
"Je
leidenschaftlicher der Gedanke gegen sein Bedingtsein
sich abdichtet um des Unbedingten willen, um so bewußtloser,
und damit verhängnisvoller, fällt er der Welt zu.
Selbst seine eigene Unmöglichkeit muß er noch begreifen
um der Möglichkeit willen." (ADORNO, Minima
Moralia, S.334)
Damit sind wir mitten im Thema: ADORNO und HORKHEIMER
versuchen "die Verflechtung von Rationalität
und gesellschaftlicher Wirklichkeit, ebenso wie die davon
untrennbare von Natur und Naturbeherrschung, dem Verständnis
näher zu bringen" (S.5).
Gegenstand der Untersuchung ist die Selbstzerstörung der
Aufklärung. Es geht nicht um die Beschreibung einer
Verfallsgeschichte, deren Aufhebung darin läge, zu den
Wurzeln zurückzukehren, noch geht um die Stillegung des
Prozesses.
"Wir
hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere petitio
principii -, daß die Freiheit in der Gesellschaft vom
aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben
wir, genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff
eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten
historischer Formen, die Institutionen der Gesellschaft,
in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt
enthalten, der heute überall sich ereignet" (S.3).
Da diese Aporie nicht nur die
von Begriffsbestimmungen ist, sondern auch auf die
gesellschaftliche Realität bezogen ist, muß jede
voreilige Auflösung fragwürdig erscheinen. Es gilt
eher, den Sinn dieses Widerspruchs zu entfalten.
Ziel der Aufklärung von je her war es, "von den
Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren
einzusetzen." (S.9)
Herren, worüber? Es geht um die Herrschaft über die
Natur, die Entzauberung der Welt und den Sturz der Mythen.
Das Wissen, das der Natur gebietet, bedeutet Macht, nie
schon Bacon bemerkte. Das Wesen dieses Wissens ist seine
technologische Struktur. Nicht Wahrheit, sondern das
wirksame Verfahren, die Methode werden bedeutsam. Von der
Natur nur das, was auf sie selbst und die Menschen
anwendbar ist, gilt es zu lernen. Was sich dem Maß von
Berechenbarkeit und Nützlichkeit nicht fügt, scheint
verdächtig. Dieser Prozeß war jedoch schon vor der
Etabiierung der neuzeitlichen Wissenschaft in Gang
gekommen.
Die reale Übermacht der Natur, das Übersinnliche und
Transzendente, wurden erfahren als Verschlungen-werden.
Das religiöse Prinzip des Mana kennzeichnet die mythisch-animistische
Zeit.
"Primär,
undifferenziert ist es alles Unbekannte, Fremde; das was
den Erfahrungskreis transzendiert, was an den Dingen mehr
ist als ihr vorweg bekanntes Dasein." (S.21)
Der Schreckensruf, "mit dem das Unbekannte erfahren
wird, wird zu seinem Namen" (ebd.). Er fixiert das
Transzendente gegenüber dem Bekannten, begleitet vom
Schauder der Heiligkeit. In der Differenzierung von
Belebtem und Unbelebtem, der Besetzung bestimmter Orte
mit Dämonen ist die Trennung von Subjekt und Objekt
schon angelegt. In den vorsokratischen Kosmologien
scheiden sich die Götter von den Stoffen und in der
griechischen Metaphysik vergeistigt sich die mythische
Vieldeutigkeit "zur reinen Form der ontologischen
Wesenheiten".(S.12)
Doch der Aufklärung in der
Neuzeit, vom Rationalismus bis zum Positivismus, galten
die Universalien zunehmend selbst noch als Aberglaube. "In der
Autorität der allgemeinen Begriffe meint sie noch die
Furcht vor den Dämonen zu erblicken,(...). Von nun an
soll die Materie endlich ohne Illusion waltender oder
innewohnender Kräfte (...) beherrscht werden." (ebd.) Alles,
was darüber hinausgeht, wird zur Projektion von
Subjektivem auf die Natur, also als Anthropomorphismus
gedeutet. Der Angst glaubt der Mensch dadurch ledig zu
sein, daß es nichts Unbekanntes mehr gibt. "Aufklärung
ist die radikal gewordene, mythische Angst." (S.22)
In der Bestimmung der Materie als raum-zeitlich
verortbare, qualitätslose Massepunkte und der Fixierung
von Naturgesetzen ist jede Sicht auf Neues versperrt,
stets wird es aus dem Alten, Bekannten erklärt. Es kann
nichts Neues geben, da die Vernunft immer nur dasselbe
wiedererkennt, das Konstitutionsgesetz der Dinge in sich
trägt. Hier enthüllt sich auch der ursprüngliche Sinn
des Mathematischen:
Mathemata ist jenes "an" den Dingen, was wir
eigentlich schon kennen, nicht erst aus ihnen
herausholen, sondern selbst schon mitbringen. Die Gegenstände
der Erfahrung werden ihrer je bestimmten Physiognomie
entkleidet und zu mathematisch-physikalisch bestimmbaren
Dingen an sich ihnen wird, wie Husserl es einmal ausdrückte,
ein "Ideenkleid" übergeworfen.
Im System, aus dem sich jedes Faktum, jeder Prozeß
ableiten läßt, findet die Vorbestimmtheit seinen
Ausdruck. Natur scheint begriffen, in den Griff genommen
zu sein. "In der Verwandlung enthüllt sich
das Wesen der Dinge immer als je dasselbe, als Substrat
von Herrschaft". (S.15) "Als je dasselbe" wird
das Besondere zum Gleich-gültigen; Exemplar eines
Allgemeinen, es wird vergleichbar.
Die Reduktion auf abstrakte Größen macht
Ungleichnamiges komparabel. Bestimmend bleibt das Prinzip
des Äquivalents, die Abstraktion vom Besonderen und Zufälligen.
So wurde auch die formale Logik, gleichgültig gegenüber
dem unter ihr Subsumierten, zur großen "Schule der
Vereinheitlichung". (S.13)
Der Prozeß zunehmender Abstraktion, um der Verfügung
willen, wird erkauft durch eine "fortschreitende
Distanz zum Objekt". (S.17) In der bürgerlichen
Gesellschaft hat dieses Denken sein Komplement in der
abstrakten Arbeit, deren Ausbreitung ihre vorgeblichen
Subjekte nicht unberührt läßt, sondern als äußerer
und innerer Zwang zur Konformität treibt.
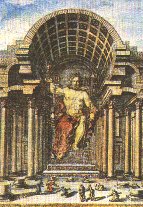
Halten
wir einen Moment inne. Schon der patriarchale Zeus-Mythos
selbst ist Aufklärung. "Als sprachlich entfaltete
Totalität, deren Wahrheits-anspruch den älteren
mythischen Glauben, die Volksreligion herabdrückt" (S.17), kann er
sich mit der philosophischen auf einer Ebene messen.
Sofern gezeigt werden kann, daß ein Mythos selbst mit
einem verdrängenten Wahrheits-anspruch auftritt, kann
gesagt werden, die Mythologie habe selbst den endlosen
Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt, "in dem mit
unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede
bestimmte theoretische Ansicht der vernichtenden Kritik
verfällt, nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch die
Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklärung
zum animistischen Zauber geworden sind." (ebd.)
Das Identische in dieser
Bewegung bleibt dabei die zersetzende Kritik. Indem die
Aufklärung schon im Mythos wurzelt, allen Stoff von den
Mythen empfängt, um sie zu zerstören, gerät sie selbst
als Richtende in den mythischen Bann. "Sie will
dem Prozeß von Schicksal und Vergeltung sich entziehen,
indem sie an ihm selbst Vergeltung übt." (S.18)
Mit jedem Schritt, den die Aufklärung zu ihrer Befreiung
unternimmt, verstrickt sie sich tiefer in Mythologie. Die
Nichtigkeit der Tatsache in seiner Gleichgültigkeit als
bloßes Exemplar eines Allgemeinen, ist die Wiederkehr
des mythischen Worts: Alles Geschehen muß dafür Buße
tun, daß es geschah. Das Schicksal, der mythische
Kreislauf kehrt in der Gesetzlichkeit wieder, hält "den
Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen Vergegenständlichung
im Naturgesetz er sich als freies Subjekt gesichert wähnt." (S.18)
Die Herrschaft über die äußere Natur wendet sich gegen
das denkende Subjekt selbst. Es muß sich, dem
allumfassenden logischen Formalismus gehorchend, unters
Vorfindliche unterordnen. Nicht nur die Begriffe, die
Sprache werden entmythologisiert, auch die menschlichen
Beziehungen und Verhaltensweisen müssen "rationalisiert"
werden.
In dieser Bewegung geraten
das Leibliche, Triebhafte, gar das natürliche Ich unter
die Regentschaft eines transzendentalen Subjekts als
gesetzgebender Instanz des Handelns. Beseitigt die
moderne Wissenschaftstheorie selbst dieses noch, so verflüchtigt
sich die letzte Erinnerung an Subjektivität. Aus der größten
Distanz zum Objekt fällt das Subjekt wieder zurück in
die, von ihm verstümmelte Natur.
"Wenn
alle Psychologie seit der des Protagoras den Menschen erhöhte
durch den Gedanken, er sei das Maß aller Dinge, so hat
sie damit von Anbeginn zugleich ihn zum Objekt gemacht,
zum Material der Analyse, und ihn selber, einmal unter
die Dinge eingereiht, deren Nichtigkeit überantuortet. (ADORNO,
MM, S.75) "Die älteste Angst geht in Erfüllung,
die vor dem Verlust des eigenen Namens." (S.37)
Doch wieder sind wir einen
Schritt zu weit gegangen. Wer seinen Namen verlieren
kann, muß ihn zuvor besitzen, muß sich als identisches
Wesen wissen. Die Frage zielt auf das Erwachen der
Subjektivität.
 Wenden wir uns Odysseus zu, dem
Helden unserer Zivilisation. In der homerischen Odyssee
wird die Geschichte der Sub-jektkonstitution verräumlicht. Wenden wir uns Odysseus zu, dem
Helden unserer Zivilisation. In der homerischen Odyssee
wird die Geschichte der Sub-jektkonstitution verräumlicht.
"Die
Irrfahrt von Troja nach Ithaka ist der Weg des leibhaft
gegenüber der Naturgewalt unendlich schwachen und im
Selbst-bewußtsein erst sich bildenden Selbst durch die
Mythen." (S.53)
Durch die Todesgefahren hindurch ist der Held mündig
geworden, hat seine Identität als Person gehärtet. Doch
das Bedrohliche, Abenteuerliche war - bei Gefahr des
eigenen Untergangs, des sich selbst wieder Verlierens -
mit einem Glücksversprechen verschwistert.
"Die
Anstrengung, das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf
allen Stufen an, und stets war die Lockung es zu
verlieren, mit der blinden Entschlossenheit zu seiner
Erhaltung gepaart." (S.40)
Um die Selbsterhaltung zu
sichern und die Abenteuer zu bestehen, bedarf es der List.
Den Naturgewalten, den Göttern zu opfern dient dem
eigenen Überleben. Doch planmäßig eingesetzt, liegt
darin ein Moment des Betruges. Die Götter werden
beherrscht, zuletzt gestürzt, gerade durch das System
der ihnen widerfahrenden Ehrung.
"Die
Einschränkung des amorphen Meeresgottes auf eine
bestimmte Lokalität, den heiligen Bezirk, schränkt
zugleich seine Macht ein, und für die Sättigung an den
äthiopischen Ochsen muß er darauf verzichten, an
Odysseus seinen Mut zu kühlen." ( S.57)
Die List des Odysseus besteht darin, als Opfer und
Priester zugleich zu fungieren. Er kalkuliert seinen
Einsatz und bewirkt eine "Negation der Macht, an
welcher der Einsatz geschieht".(ebd.)
In der "Vorbeifahrt an den Sirenen", deren Lockung
mit dem Verlust des eigenen Selbst bezahlt würde, gibt
es für Odysseus nur zwei Wege des Entrinnens:
# Den Gefährten,
den Knechten werden die Ohren mit Wachs verstopft, sie dürfen
nichts hören, wenn sie bestehen wollen. Als Arbeitende müssen
sie nach vorwärts blicken.
"Den
Trieb, der zur Ablenkung drängt, müssen sie verbissen
in zusätzlicher Anstrengung sublimieren. So werden sie
praktisch." (S.40)
# Odysseus als
Grundherr, der ändere für sich arbeiten läßt, hört
ohnmächtig zu. Doch das Gehärte bleibt für ihn
folgenlos, er bleibt an den Mast gefesselt. In dieser
grandiosen Triebunterdrückung wird der Gegenstand der
Verlockung zur Kunst neutralisiert.
Wohlüberlegt greifen auch
die jeweiligen Beschränkungen von Herr und Knecht
ineinander. Der Herr, befreit von der Arbeit, bleibt doch
unselbständig oder wie Hegel es ausdrückt: "Der Herr
aber, der den Knecht zwischen es (Naturding) und sich
eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständigkeit
des Dinges zusammen und genießt, es rein; die Seite der
Selbständigkeit aber überläßt er dem Knechte, der es
bearbeitet." (S.41)
Ihre Selbständigkeit weiß aber nicht um die Schönheit
des Gesanges der Sirenen, sondern nur von der Gefahr, so
daß das ungehörte Flehen um Befreiung vergeblich bleibt.
Doch auch die selbständige Arbeit ist eine Form von
List, die auf den Betrüger zurückschlägt. Denn nur die
"bewußt gehandhabte Anpassung an die Natur bringt
diese unter die Gewalt des physisch Schwächeren". (S.64)
Wir zitieren wiederum Hegel:
 "Das
Werkzeug hält als solches vom Menschen sein materielles
Vernichten ab; aber es bleibt darin (...) seine Tätigkeit
(...) In der Maschine hebt der Mensch selbst diese seine
farmale Tätigkeit auf und läßt sie ganz für ihn
arbeiten. Aber jener Betrug, den er gegen die Natur ausübt,
(...) rächt sich gegen ihn selbst; was er ihr abgewinnt,
je mehr er sie unterjocht, desto niedriger wird er selbst.(...)
so hebt er die Notwendigkeit seines Arbeitens nicht auf,
sondern schiebt es nur hinaus, entfernt es van der Natur,
und richtet sich nicht lebendig auf sie als eine
lebendige; sondern es entflieht diese negative
Lebendigkeit, und das Arbeiten, das ihm übrigbleibt,
wird selbst maschinenmäßiger", macht ihn selbst
zum Ding. (zit. nach HABERMAS, Technik u.
Wissenschaft... ,S.26f) "Das
Werkzeug hält als solches vom Menschen sein materielles
Vernichten ab; aber es bleibt darin (...) seine Tätigkeit
(...) In der Maschine hebt der Mensch selbst diese seine
farmale Tätigkeit auf und läßt sie ganz für ihn
arbeiten. Aber jener Betrug, den er gegen die Natur ausübt,
(...) rächt sich gegen ihn selbst; was er ihr abgewinnt,
je mehr er sie unterjocht, desto niedriger wird er selbst.(...)
so hebt er die Notwendigkeit seines Arbeitens nicht auf,
sondern schiebt es nur hinaus, entfernt es van der Natur,
und richtet sich nicht lebendig auf sie als eine
lebendige; sondern es entflieht diese negative
Lebendigkeit, und das Arbeiten, das ihm übrigbleibt,
wird selbst maschinenmäßiger", macht ihn selbst
zum Ding. (zit. nach HABERMAS, Technik u.
Wissenschaft... ,S.26f)
Die Dialektik der Aufklärung
zeigt sich hier sehr deutlich, wo die Vertretbarkeit (dh.
die Befreiung von der Arbeit durch instrumentellen
Einsatz von Arbeit und Wissenschaft) als Maß von
Herrschaft Vehikel des Fortschritts der Naturbeherrschung
ist und zugleich Regression.
Die listige Angleichung des Subjekts an die Objektivität,
an die von ihm selbst zugerichtete Natur ist eine Mimesis
an das Tote.
"Die
Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein
Selbst begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung
des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht, denn die
beherrschte, unterdrückte und durch Selbsterhaltung
aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das
Lebendige, (...) eigentlich gerade das, was Erhalten
werden soll." (S.52)
Gibt es eine Möglichkeit,
diesen Prozeß der zunehmenden Selbstzerstörung
aufzuhalten?
Die Hypostasierung der Utopie, das Ausmalen des Bildes
der Versöhnung, ebenso wie die resignierte Hereinnahme
der Entzweiung in die "Condition humaine"
geraten zum Betrug.
"Gerettet
wird das Recht des Bildes in der treuen Durchführung
seines Verbotes." (S.30)
Zuallererst muß sich das Denken auf seine eigene Schuld
besinnen. Der Fortschritt der Zivilisation ist auf den
Begriff angewiesen, denn er distanziert nicht bloß - als
Instrument der Naturheherrschung - den Menschen von der
Natur, sondern "als Selbstbesinnung eben des Denkens,
das in der Form der Wissenschaft an die blinde ökonomische
Tendenz gefesselt bleibt, läßt er die das Unrecht
verewigende Distanz ermessen." (S.47)
Ein Denken, das so auf sich selbst als Zwangsmechanismus
reflektiert, vernimmt sich selbst als vergessene und
zugerichtete Natur. Aufklärung, in diesem Sinne des
Eingedenkens der Natur im Subjekt, ist der Herrschaft
entgegengesetzt.
"Mit
konsequenzlogischen Mitteln trachtet sie, anstelle des
Einheitsprinzips und der Allherrschaft des übergeordneten
Begriffs die Idee dessen zu rücken, was außerhalb des
Banns solcher Einheit wäre." (ADDRNO,
Negative Dialektik, S.3)
Nimmt man dieses Denken
ernst, und es sollte ernst genommen werden, so ergeben
sich folgenreiche Konsequenzen. Es unterläuft dort die
Gegenüberstellung von traditioneller und kritischer
Theorie, wo sie gemeinsam als einheitliches System sich
darstellen, gleich ob in Form von Naturwissenschaft oder
Geschichtsphilosophie. Auch wird die Arbeit, Motor
individueller und gesellschaftlicher Selbsterhaltung,
insofern negiert, als sie den Primat für die Bestimmung
der Lebensvollzüge abgibt.
"Eingedenken
der Natur im Subjekt" heißt aber auch, die Idee der
Autonomie, den Versuch einer absoluten Selbstbegründung
preiszugeben. Denn dies war in den bisherigen Ausführungen
ungenannt gegenwärtig.
Alles Sein vor den Richterstuhl der Vernunft zu stellen
und auf seine Existenzberechtigung hin zu befragen, sich
selbst als unbedingt zu setzen ist von der Idee der
Autonomie unlösbar und führt zur Selbstzerstörung.
Erst wenn wir die Vorgegebenheit als Unvordenklichkeit
begreifen, werden wir die Natur, innere wie äußere,
nicht mit einem Netz von Kategorien und Bestimmungen
einfangen, sondern ihre Dignität wahren.
* (Der kleine
einführendeText entstand in einem Seminar an er
FU Berlin, wo vornehmlich sprachanalytische Theorien zu
"Rationalität" verhandelt wurden. Wir haben
dort über die Rationalität von Meinungen, über
Handlungsrationalität, begründetes Kausalwissen, über
rationale Lebenspläne und Wünsche gesprochen).
Hier plaziert soll er nur als Einladung zum
Selbst- oder Wieder-Lesen dienen !
Adorno
Horkheimer bei 
|
