
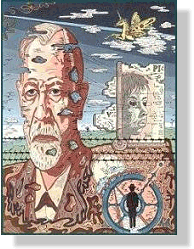 |
Assoziationen
zum Verhältnis von Kunst und Gestaltungstherapie, Bild, Sprache und Primärprozeß * Teil 2 |
| Die Phantasie ist eine anarchische Kraft | |
| Die Mechanik des Wunsches | |
| Künstlerische Produktivität als Sublimierung | |
| Zwischenspiel: "Atmen und Schreiben" | |
| Kunst als Selbsttherapie | |
| Was eine Kinderzeichnung verrät | |
| Das Bild, das Malen und der therapeutische Dialog |
|
| Literatur | |
![]()
von
Rudolf Süsske
![]()
| Der Titel dieser
Assoziationen war ein Graffiti aus der Studentenrevolte
in Paris, Mai '68. Der Spruch korrespondiert mit einem
anderen; "Phantasie an die Macht". Phantasie,
Kreativität, Spontaneität i.S. des Unbewußten zu
wecken, birgt aber auch Gefahren, kann nicht unbesehen
gefeiert werden - dies weiß nicht allein die klinische
Erfahrung (Pat. M. s.Teil 1.) Auch die
Fremdenfeindlichkeit, der Antisemitismus treten prima
faci 'spontan' auf, wenngleich es ein Klima gibt, das sie
'hervorlockt', Interessen, die sie aufnehmen und anheizen.
Das zeigt sich häufig, wenn nach Argumenten dieses
Hasses gefragt wird; die Antworten sind stereotyp und
widersinnig. Affekt und Argument passen nicht zusammen. Also gilt es zu differenzieren: Regionen des Ubw, Formen der Kreativität und Phantasie zu unterscheiden - so wie es im Vortrag schon geschehen ist. Zu diesem Zweck unternehmen wir nun einige systematische sowie assoziative Gänge, die Fragen des Vortrags in eigener Verantwortung weiterspinnen. Einstimmend zwei Thesen zur Phantasie & Kreativität, denen eine kleine theoriegeschichtliche Einlage zum ursprünglichen Begriff des Primärprozesses bei Freud folgen wird. |
"Die Phantasie ist eine anarchische Kraft"
Sie schafft lebende Bilder. Je
mehr sie von fixierten, toten, identischen Bildern
umzingelt ist, desto mehr wird sie notwendigerweise
destruktiv: sie muß, um als Phantasie zu überleben, die
kollektiven Stereotype, die sie einengen, zertrümmern.
Der gesellschaftliche Mechanismus besteht übrigens
darin, daß die aus diesem produktiven Zerstörungsprozeß
neugeschaffenen lebenden Bilder ihrerseits vom Kollektiv
getötet, kanonisiert, fixiert werden, ewiger Wettlauf
der lebenden Phantasie mit dem sie verfolgenden Bild. Nur
das bilderschaffende Vermögen vermag auch die fixierten
Bilder wieder aufzulösen." (Elisabeth Lenk, l 983,
S.60) |
|
|
Freuds Interesse
für die Psychopathologie seiner Zeit, die Träume und
Fehlleistungen, den Wahn, scheint nur eine Fortsetzung
der romantischen Naturphilosophie des 19.Jh. zu sein.
Originäre Quellen sind aber Herbart, Fechner, Meynert -
'fortschrittliche Naturwissenschaftler‘ - aber auch
die Philosophen F.Brentano und Kant. Das Unbewußte war
ihm "das eigentlich Reale, uns nach seiner inneren
Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt
und uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso unvollständig
gegeben wie die Außenwelt durch die Angaben unserer
Sinnesorgane" (1900, S.580). Die Traumdeutung von
1900 muß in ihren wesentlichen Thesen als Freuds eigene
Leistung anerkannt werden. Er wußte dies selbst und
bemerkte mit Stolz einmal seinem Freund Fließ gegenüber:
|
|
Der manifeste, 'verrückte' Traum ist Ergebnis einer (zensierenden) Bearbeitung, die ihre eigenen Formgesetze hat (z.B. Verdichtung und Verschiebung). Die wichtigste, deutend zu rekonstuierende Quelle ist der latente Traumgedanke aus der infantilen Szenerie. Im VII. Kapitel des Werkes ändert sich dann schlagartig die Terminologie. Von Energien ist die Rede, von einer Topographie des "psychischen Apparates" (Systeme des Unbewußten, Vorbewußten, Wahrnehmungsbewußtsein) und von den Funktionen des Primär- und Sekundärvorgangs. |
"Letztes Ziel der vom Primärvorgang
gesteuerten Tendenz sind nach Freud eine Reihe von
Wahrnehmungen, die mit früheren, von lustvoller
Befriedigung begleiteten Sinnesempfindungen Identisch
sind." Das Erreichen einer derartigen
Wahrnehmungsidentität stellt "das Äquivalent für
eine vollständige oder massive Abfuhr von
Triebbesetzungen" dar. Im System Ubw herrscht das
Lustprinzip, dh. alle Objekte/Vorstellungen, die zur
Abfuhr geeignet sind, werden in Anspruch genommen, ohne Rücksicht
auf Realität und Moral. Diese hohe Beweglichkeit der
Besetzungsenergie zeigt sich z.B. in den Traummechanismen
der "Verschiebung" und "Verdichtung".
Mit anderen Tätigkeiten, wie z.B. dem Denken, ist eine
weniger eindrucksvolle Abfuhr von Triebspannungen
verbunden" (Denkidentität). "Grundlegend
charakteristisch für den Sekundärvorgang
ist die Stabilität der Besetzungsenergien". Diese
sind "insofern gebunden, als sie mit fixierten und
gleichbleibenden Wort- und Objektvorstellungen verknüpft
werden. Ein Wort oder Objekt kann nicht ohne weiteres
durch ein anderes ersetzt, noch kann ein Teil eines
Objekts verwendet werden, um das Ganze zu repräsentieren"
(Arlow/Brenner, 1976, S.73ff). Die versprachlichte Welt
bekommt so einen festen Bezugsrahmen, Logik und Kausalität,
Widerspruchsfreiheit und ein realistisches Verhältnis zu
Zeit werden denkbar. |
"Unter den Abkömmlingen
der ubw Triebregungen (...) gibt es welche, die
entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen. Sie
sind einerseits hochorganisiert, widerspruchsfrei, haben
allen Erwerb des Systems Bw verwertet und würden
sich für unser Urteil von den Bildungen dieses Systems
kaum unterscheiden. Anderseits sind sie unbewußt und unfähig,
bewußt zu werden ... Solcher Art sind die
Phantasiebildungen der Normalen wie der Neurotiker".
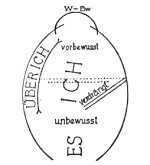 Erst in "Das Ich und das Es"
(1923) konnte er diese Beobachtungen konsequent in seine
Strukturtheorie ( mit den Instanzen: Ich, Es und Über-Ich)
einfügen. Erst in "Das Ich und das Es"
(1923) konnte er diese Beobachtungen konsequent in seine
Strukturtheorie ( mit den Instanzen: Ich, Es und Über-Ich)
einfügen.Sprache kann täuschen, ideologisch sein, über die Dinge springen, aber sie kann auch gerade selbst-täuschend arbeiten. Besonders (auto)-aggressive Tendenzen können sich sachlichster Rationalität bedienen. Manche Depressive kleiden ihre Schuldbekenntnisse in sprachlich hochstufige theologische Reflexionen. Das Über-Ich, psychogenetisch eine späte Instanz - lange nach der Spracheinführung - steht in seinem Funktionieren dem Es aber näher als dem Ich. |
| Bewußtes Denken und Sprechen ist synonym mit Sekundärvorgang, so wahrscheinlich auch ein nach festen Regeln durchkomponiertes und durchdachtes Bild, aber zumeist sind beide Bereiche primär- und sekundärprozeßhaft durchwirkt. Es böte sich jetzt an, die Geschichte dieses Begriffspaar über Freud hinaus in der Ich-Psychologie (Hartmann, Rapaport u.a.) weiter zu verfolgen, aber wir stießen in der metapsychologischen Fassung auf keine wesentliche Veränderung: immer sind Primär- und Sekundärprozeß (besetzungs)- energetische Begriffe, auch wenn sich der übrige Rahmen (Ich-Energie, Autonomiekonzept u.a.) wandelt. Ob sie den Begriff des Primärprozesses verwenden oder nicht, wie verstehen diese Autoren die 'künstlerische Kreativität'? |
Künstlerische Produktivität als Sublimierung
Es ist seit längerer Zeit Mode
geworden, literarische Werke und einige der darstellenden
Kunst wie 'Krankengeschichten' zu lesen. Dostojewskij
wurde als Junge Zeuge der Ermordung seines Vaters,
deshalb beschäftigte er sich mit "Schuld und Sühne"?
Der Landvermesser erreicht nie das "Schloß"
wie Franz Kafka nie die Liebe seines Vaters? Dies ist
sicherlich zu einfach, wie auch psychoanalytische
Interpreten zugeben. |
Wir wollen dies in toto gar nicht
in Abrede stellen, irritierend wirkt nur die selbstverständliche
Sicherheit, mit der sich die Analytiker auf der richtigen
Seite des "Realitätprinzips" wähnen. Freud
entließ seine Patienten aus dem "neurotischen"
in das allgemeingesellschaftliche Leid. Und es mag eine
Form der Pathologie sein, dieses Leid nicht zu empfinden;
Kierkegaard hat da den Analytikern einiges voraus. "Der
Traum der Vernunft gebiert Gespenster" heißt ein
Bild von Goya. Er meinte Aberglaube, Krieg und
Inquisition und malte im Zeichen der Aufklärung. Die
Betonung läge dann auf "Schlaf", aber
mittlerweile stellt sich - gerade in diesem 20.Jh. - die
Frage, ob es nicht die gegenwärtige Gestalt der "Vernunft"
ist, die diese Monstren erzeugt. |
Zwischenspiel: "Atmen und Schreiben"
In seiner Studie "Der geraubte Atem" (1991) geht F.-B. Michel der Lebens- und Werkgeschichte einiger französischer Schriftsteller nach, die unter Atemwegserkrankungen litten. Krankheit und Werk stehen in seiner Sicht nicht in einem Determinationsverhaltnis; als Leser öffnet mir der Blick in die Lebensgeschichte des Autors nur eine Sichtweise, die Hervorhebung eines Aspektes der Welt, deren Fülle an Motiven und Formen sich erst in der Auseinandersetzung mit dem selbständigen Stück Literatur erschließt. |
| "Freiheit ist ein Gefühl.
Das atmet man". Dies schrieb Paul Valery zur
Befreiung von Paris 1944. Die Metapher ist bei ihm überdeterminiert,
dh. schon immer bedeutete für ihn Atmen Leben. Valery
ist jemand, der stets hustet, zu diesem Husten ein
priviligiertes Verhältnis hatte. Dabei rauchte er: "Was habe ich heute morgen getan? Zwei Seiten Notizen. Der Geist hat mich zwischen zwei Zigaretten besucht." Husten: "Das ist zu Anfang ein unmerkliches ringförmiges Kitzeln dort, wo die Kehle sich verengt.... Dieser juckende Ring muß gekratzt werden -an einem Punkt, der für die Finger tabu ist." Kaum jemand hat das anschaulicher beschrieben. Husten sei - so Valery - "Abbild (oder vielmehr eine andere Form) der psychischen Phänomene von Unruhe und der in die Enge getriebenen Phantasie... Das ist dumm wie Bohnenstroh. Wie das Leben, der Tod" (s.Michel, S.37ff). Die Enge der Angst begleitet ihn sein ganzes Leben. Mit drei Jahren ertrinkt er fast in einem Schwanensee; zudem stirbt sein 'geistiger Vater‘ Mallarme an einem Stimmritzenkrampf. Das Ringen um Atem, die Angst vorm Ertrinken/ Ersticken, Schwäne werden zu Motiven seiner Dichtung, doch so, daß sie nicht nur auf die Geschichte des Autors rückverweisen, sondern unseren Sinn - den des Lesers - für Erfahrungen öffnen, die wir ansatzweise selbst durchlebten, für die wir aber nie einen Ausdruck fanden. "Ängstlich um Azur ringend, von Ruhmsucht verzehrt, Brust, Abgrund von Schatten mit Fleischesnüstern, Atme diesen Weihrauch aus Seelen und Rauchschwaden ein, Der aus der Stadt wie aus dem Meer aufsteigt!" Die poetische, formgebende Verfremdung individueller Erfahrung bringt sie in das dialogische Zwischenreich, wo sich Exklusivität und öffentliche Teilhabe kreuzen. Bei diesem Beispiel wird die Angst als Thema in eine dichterische Form gebracht, die als Form von der Angst nicht tangiert wird. Valery - dem viel an der Strenge der Sprache in Wort und Schrift lag - veröffentlichte nie die folgenden Zeilen, in denen das Thema die Form (am Schluß) aufreißt: "Schrei, der all mein Fleisch durchdringt und seine ganze eigne Stimme sucht, wo ich zum ersten Mal zu schreien glaubte, als ob ich eine neue Stimme gebäre und ich erkannte meine Stimme es zerriß mich zum ersten Mal." Eine andere Weise, Thema und Form aufeinander zu beziehen, entnehme ich einer Gedichtzeile von Jandl: "Der Mund ist ochen". Es heißt nicht "der Mund ist offen", wie es sprachlich korrekt wäre, aber was ist korrekt? Jandl bringt hier die phonetische Lautbildung beim Lesen - das Schließen des Mundes, um den f-Laut zu bilden - in Konflikt mit dem Bedeutungsgehalt der Zeile; ganz spielerisch schließt er die Kluft zwischen Vollzug und Reflexion, Dargestelltes und Darstellung. Gedichte sind sicher eine besondere Weise, nicht nur etwas darzustellen, sondern oft mehr noch, die Sprache als Sprache zu thematisieren - Sprache ist ja das Medium, das sich selbst reflektieren, kommentieren kann. Poesie der Prosa gegenüberzustellen und erstere dem Bild und Primärprozeß näher zu rücken, verkennt vielleicht a) den hochartifiziellen Charakter vieler Gedichte und denkt zu sehr b) an das romantische Bild vom "Dichtergenie". Zudem c) differenziert sich Prosa in die Vielfalt von phantastischer, realistischer ua. Erzählung und der prosaischen Alltags- und Wissenschaftssprache. Jeweils neu gilt es zu unterscheiden, wo Primärprozeßhaftes, sofern wir diesen Begriff beibehalten wollen, sich zeigt:
Sodann müssen wir auch nochmals die doppelte Infantilität des primärprozeßhaften Denkens befragen: sie meint die kindliche Szenerie als Inhalts- und Themenebene, aber auch die Logik (oder gerade Un-logik) dieses Denkens. Vielleicht lassen sich die beiden Aspekte entkoppeln? |
| Für viele Künstler scheint mir der Rückgriff auf kindliche Ausdrucksformen (Alogik der Sprache oder Aufgabe der perspektivischen Malerei) nicht allein Regression, sondern eine Progression, die gerade durch die Analyse des verbindlich Geregelten, das was als 'Realität' gilt, hindurchgegangen ist. Die interessanteste, geschichtsphilosophische These vertrat hier sicher Heinrich v. Kleist in seinem "Marionettentheater". Dem können wir hier aber nicht nachgehen. Es ließe sich auch an Lewis Carroll - einen vortrefflichen Logiker - denken, dessen "Alice im Wunderland" weit 'aufsässigere' Bilder enthält als die bürgerlich domestizierte Märchensammlung der Gebrüder Grimm. |
Kunst als Selbsttherapie
G.Benedetti berichtet von einer
amerikanischen Untersuchung über zeitgenössische
Autoren, die überdurchschnittlich an Depressionen mit
Krankheitswert litten: Schreiben als Selbsttherapie, was
das Werk aber nicht pathologisch machen muß. |
Ganz im Sinne der hier
vertretenen These schreibt Benedetti im Folgenden: "Treten
die Ungeheuer aus dem tätigen Ich hervor, so verfälschen
sie die Realität nicht, sondern sie deuten sie. Die
Realität wird als Not der Zeit gedeutet. Die Zeichnungen
werden zu 'Warntafeln', die der Künstler für uns
aufstellt". Paradoxerweise bringt der Künstler sein
'Projekt' in der Welt zur Anwesenheit, indem er sich in
seinem Tun verliert. In der Komposition der Formen, dem
Setzen der Farben vergißt der Maler - nach eigener
Aussage - für die Dauer der Arbeit die Welt um sich
herum (dh.Welt-Darstellung, die sich temporär einem
Weltverlust verdankt). |
|
Anmerkung zum
Projektionsbegriff
Bei Freud kommt nun ein Drittes
hinzu: Projektion trägt mitunter auch eine
pathologisierende Bedeutung. Eigene unbewußte,
aggressive 'Anteile' werden auf den Anderen projiziert,
tragen zu einer Realitätsverfälschung bei. |
Was eine Kinderzeichnung verrät
Die neue Überschrift scheint nur
einen thematischen Bruch zu kennzeichnen.
Kinderzeichnungen sind zwar kreativ, aber unrealistisch.
Kinder malen die Welt nicht, so wie sie ist. Merkwürdigerweise
finden wir aber Elemente dieser Darstellungen in der
modernen Malerei wieder. Biedere Museumsbesucher stehen
vor einem Bild und meinen: 'das kann meine
Tochter auch!' |
|
Anfänge der Kinderzeichnung: Kritzelzeichnungen, darunter Rundkritzeln, Schreibkritzeln, Kreuzform. Aus H Daucher, Künstlerisches und ratio-nalisiertes Sehen. München 1967, S 119 |
Die ersten Kritzeleien eines Kindes - ich folge hier den Ausführungen von M.Karlson (1987) - entstehen häufig aus der Nachahmung von Schreibewegungen. Zuerst ist es die Lust an der Bewegung, grobkoordiniertes Gekritzel (Kreisformen) mit dem Stift auf relativ kleiner Fläche. Es entsteht eine dunkle Stelle, die die visuelle Aufmerksamkeit an sich zieht. Kontraste werden hervorgebracht, wobei der sensorisch-motorische Bewegungs- eindruck vorherrscht. Das Auge folgt der Hand und ihrem Spiel. Die Bewegung weiß sich noch nicht dem 'kontrollierenden Blick' untertan. Bald wandeln sich die Kritzel- bewegungen in gerichtete Ortsveränderungen: "'Die sinnlich, lustbetonten Kurven der frühen ...Stufe werden seltener und abgelöst von harten Geraden, die entschieden von hier dorthin wollen' (Daucher). Die Bewegung des Zeichenstifts auf der Ebene des Papiers ist nun den Bewegungen des Kindes im Raum, seinem Krabbeln und Gehen ... vergleichbar. |
Den Zeichnungen kommt bislang
keine darstellende i.S. abbildender Funktion zu. Die
Bilder verkörpern eher Spuren als Bedeutungen. Wenn die
Kritzeleien mehr als sich selbst oder die Spuren des
senso-motorischen Selbstausdrucks vorstellen, dh. etwas
'bedeuten' (Bedeutung haben & auf etwas
anderes hindeuten), müssen zwei Voraussetzungen erfüllt
sein: "Zum einen ein Verständnis symbolischer
Beziehungen (die Dinge haben einen Namen, ein Name steht
für verschiedene Dinge, ein Ding steht für ein anderes
etc.), zum anderen die Tendenz des Auges, wahrgenommene
Zeichen und Formen willkürlich zusammenfassen und zu
vertrauten Gestalten zu ordnen" (ebd.S.335). |
|
Entwicklung der Menschendarstellung. a nachträglich als >Mutta< benanntes Kritzelzeichen; b-d Kopffüßler; in e sind die Beine einem Rumpfzeichen angefügt, allerdings fehlt die Gesichtsgestalt; in f ist die Nase außen der Gesichtsform angesetzt, in ihr sind die Zeichen für Augen und Mund. Die Zahlen sind Altersangaben in Jahren und Monaten. Aus: H. Meyers, Die Welt der kindlichen Bildnerei. Witten 1957, S.51f. |
Das Kind bringt in starkem Maße
auch die nicht-visuellen Qualitäten ins Bild, z.B. das
Tastbare, Feste, das durch dicke und dunkle Konturen
verdeutlicht wird. Die Proportionen entsprechen nicht den
meßbaren Größenverhältnissen, sondern ihrer (gefühlshaften)
Bedeutung - Wichtiges muß groß und im Zentrum
dargestellt werden. Das Kind will mit den Zeichnungen
sich verständlich machen, es fügt dazu Details an, die
aus der erinnerten (und phantasierten!) sinnlich-leiblichen
Erfahrung mit dem Gegenstand stammen. Es erzählt
eigentlich eine 'Geschichte' mit dem Bild - ganz im
Gegensatz zum Augenblicksdokument eines Photos (obgleich
wir auch bei guten Photos Geschichten zu erzählen vermögen,
aber nur dann, wenn diese auch einen erinnerungs- und
erfahrungsversammelnden Charakter tragen). |
Karlson weist noch darauf hin, daß
das Kind wie der Künstler einen Kompromiß herstellen muß
zwischen bildnerischem Ausdruck und Darstellungsabsicht.
'Ausdruck' meint dabei doch wohl: subjektiv- bedeutsam
und 'Darstellung': die eines objektiv Dargestellten bzw.
Abbildbaren. Aber was zeigt uns der Marktkarren? |
Detailbezeichnung in der
Gegenstandsdarstellung. a Marktkarren mit Äpfeln; b
Tisch mit runder Vase. Zeichn. 5 1/2 jähriger Kinder. |
|
Dieser fertigt verschiedene Ansichten an, um den Gegenstand vollständig zu haben, wirklich 'ganz' hat er ihn aber erst im Bauplan. Doch im Plan entschwindet ihm zugleich der Karren, wie er vor ihm steht - das Kind hat in Annäherung beides. Genauer: die Kinderzeichnung ist nicht linearperspektivisch (sogenannte 'realistische' Zeichnung), aber auch nicht perspektivfrei wie der Plan, der weniger ein Bild als eine Idee ist. Das Kind malt poly-perspektivisch: es bringt in das Bild, das hier und jetzt vor uns liegt, die Zeit des Herumgehens, Erfahrens mit hinein; aber indem es dies im zeitlosen Bild versammelt, zeigt es uns - ohne selbst darum zu wissen - der Karren hat seine vier Räder als er selbst, unabhängig von der zeitlich strukturierten Erfahrbarkeit. Das Kind läßt sich noch von der Welt anmuten, sofern es die Gelegenheit dazu hat. Wir begreifen die Dinge erst, wenn wir wissen, wie sie (potentiell) herstellbar sind; denken, wir wüßten was Natur ist, wenn wir den 'genetischen Code' entschlüsselt haben. Aber die Natur und die Dinge haben eine Rückseite, die sich unzivilisierbar, dem kategorisierenden Verstand entzieht. Dem Ausdruck zu verleihen, vesuchten Maler wie Cézanne. Sie malen nicht das Unsichtbare eines Innenlebens, sondern den Widerstreit in den Dingen selbst, obgleich dieser durch sie - durch ihre leibliche Existenz - hindurchgegangen ist. |
"Die Dinge sind da, nicht mehr nur wie in der Perspektive der Renaissance nach ihrem projektiven Augenschein und den Erfordernissen des Panoramas, sondern im Gegenteil aufrecht, eindringlich, mit ihren Kanten den Blick verletzend, jedes eine absolute Gegenwart beanspruchend, die mit der der anderen unvereinbar ist und die sie dennoch alle gemeinsam haben kraft eines Gestaltungssinnes, von dem der 'theoretische Sinn' uns keine Idee vermittelt". Maurice Merleau-Ponty |
| Diese Überlegungen haben sich
weit von den anfänglichen Betrachtungen zum Verhältnis
von Gestaltungstherapie und Kunst wegbewegt, letztere
gerade in der Hinsicht herausgestellt, in der sie sich
von den schöpferischen Arbeiten der Patienten
unterscheidet. Jedoch lassen sich auch Bilder von Cezanne nicht einfach mit denen von Francis Bacon vergleichen. Der Vergleich mit den Kinderzeichnungen macht Kinder nicht zu Künstlern oder umgekehrt. Ein Kind vermag die linearperspektivische Darstellung nicht hervorzubringen, auch wenn es dies gern möchte, es ist von seiner Entwicklung her nicht frei dazu. Ein Maler kann so malen, aber er setzt sich über diese Normierung der Erfahrung hinweg bzw. 'sein' Erleben drängt ihn zu deren Überschreitung. |
Das
Bild, das Malen und
der therapeutische Dialog
Wenn Patienten malen und
zeichnen, so oftmals das erste mal seit Jahren und z.T.
mit einem gewissen Unbehagen, nicht 'richtig' zeichnen zu
können. Sie messen sich dabei an den ihnen vertrauten ästhetischen
Standards. Im begleiteten Vollzug gewinnen sie jedoch
bald Selbstvertrauen, sie vergessen die ästhetischen
Konventionen, weil die Sache selbst und der Prozeß der
Gestaltung wichtiger werden. Ein weiterer Punkt spielt
hier noch hinein: Die 'Regeln' der Bildgestaltung haben
nicht den verbindlichen Charakter wie die der Sprache, so
muß das Bild - nach der Eingangsphase - nicht so
kontrolliert werden. Unbewußte und vorbewußte Elemente
scheinen im Gemalten eher durch, sprachliche
Fehlleistungen, Differenz von Wort und Mimik haben
es da schon schwerer.
|
|
||
Auf dem Blatt Papier stehen
Metaphern in einer Konstellation: die 'Spinne' für das
Bedrohliche; die 'Sonne' verkörpert erlebte oder
erhoffte gute Zeit; der 'grüne Weg' vom Fluß in den
Himmel steht für den Fortschritt in der eigenen
Entwicklung. Auch Farben und Formen - wenn sie selbst die
Darstellung bestimmen - tragen symbolischen Charakter. In
ihrem Bedeutungskern sind sie gerade nicht individuell,
es sind kollektiv geteilte Interpretations- muster, was
aber nicht heißen muß, sie seien als 'archetypische
Urbilder' in einem kollektiven (anonymen) Unbewußten
hinterlegt. Nüchtern gesprochen, deuten sie eher auf
eine stereotypisierte Erfahrung. Das Individuelle liegt
in der je besonderen Form, d.h. wie die Muster angeeignet
und dargestellt werden. Z.B. ein 'Käfig': Kernbedeutung
scheint ja wohl Unfreiheit, Gefangenschaft, Enge;
vielleicht auch fragwürdige Sicherheit.
|
Literatur
Arlow, J.A./ C.Brenner (1976); Grundbegriffe der Psychoanalyse, Reinbek
Bader, A. (1974): Die Beziehung zur Umwelt in den Bildern Schizophrener, in: Broekman/ Hofer (Hg.): Die Wirklichkeit des Unverständlichen, Den Haag 1974, S.228-240
Barthes, R. (1980): Lecon/Lektion, Frankf./M.
Benedetti, G. (1992): Schöpferische unbewußte Fähigkeit der Bewältigung des Leidens - der Patient als Künstler, Vortragstext Köln (s.Petersen)
Brenner, C. (1972): Grundzüge der Psychoanalyse, Frankf./M.
Freud, S. (1900): Die Traumdeutung, St.Ausg., Bd.2. Frankf./M.
Heise, J. (1989): Traumdiskurse, Frankf./M.
Jacobson, E. (1978): Das Selbst und die Welt der Objekte, Fnm
Junge, H. (1990): Maltherapie bei psychiatrischen und psychosomatischen Krankheiten, DKZ 10/90, S.733-738
Karlson, M. (1987): Spuren des Sinnlichen, in: J.Belgrad u.a.(Hg) Zur Idee einer psychoanalytischen Sozialforschung»Frank./M., S.331-346
Kuiper, P.C. (199l): Seelenfinsternis, Frankf./M.
Lenk, E. (1983): Die unbewußte Gesellschaft, Münch.
Merleau-Ponty, M. (1967): Das Auge und der Geist, Hamb.
Michel, F.-B. (1991): Der geraubte Atem, Zürich
Petersen, P. (1992): Von der Notwendigkeit der Kunst in der Medizin, Vortragstext, Köln: 'Therapie als Kunst - Kunst als Therapie'. XXI. Jahrestagung d.Dt.Ges.f.psychosom. Geburtshilfe und Gynäkologie, 1.-4.4.92
zurück
zum Teil 1
A. "Von der Aufsässigkeit der Bilder"
rs@suesske.de © Entstanden im Rahmen der
Weiterbildung in der Abt.
Psychotherapie/Psychosomatik (Christl. Krankenhaus Quakenbrück)
Mai 1992
last
updated 26.8.99